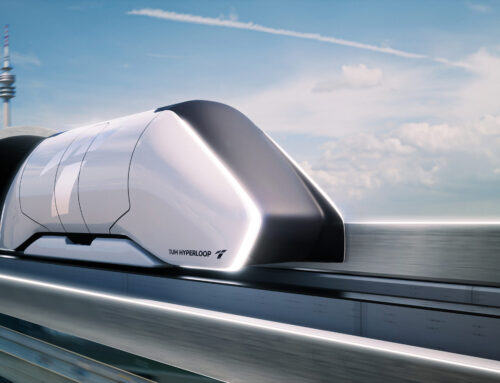Federn fallen in großen Mengen an. Sie bestehen aus dem unverdaulichen Protein Keratin. Zwar gibt es viele Verwendungsmöglichkeiten, bei denen man die Verwendung der Federn sofort erkennt. Doch was geschieht mit dem Rest? Den Federn, die nicht dekorativ und kuschelig sind?
Federn lassen sich vielfältig verwenden – Daunenjacken, Federbetten, Badmintonbälle oder Dekoartikel sind nur einige Beispiele. Aber was geschieht mit den vielen Federn, die hierfür nicht geeignet sind oder mit denen aus Alttextilien? Da sie schlecht brennen, ist sogar die energetische Nutzung keine gute Lösung. Häufiger Ausweg: Sie werden weltweit in großen Mengen deponiert. Sie bestehen genau wie Haare oder Fingernägel aus Keratin, einem Protein, das für komplexer strukturierte Lebewesen wie Säugetiere oder Vögel unverdaulich ist. Nichtsdestotrotz haben die Menschen über die Jahrhunderte – wie für alle Reststoffe aus der Landwirtschaft – auch für Federn Verwertungswege gefunden. Sie können beispielsweise durch Hydrolyse aufgespalten und zu sogenanntem Federmehl abgebaut werden, welches dann in Tierfutter zum Einsatz kommt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob durch gezielte chemische Modifikation nicht auch deutlich höherwertige Anwendungen möglich sind. So bestehen viele traditionelle Klebstoffe aus Proteinen, z. B. Knochenleim. Und auch Milch- oder Erbsenproteine lassen sich zu Klebstoffen verarbeiten. Das Keratin aus Federn für die Herstellung von Klebstoffen zu nutzen, könnte also ein großes Potential in sich tragen.
In einer Kooperation des Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) in Bremen, der Universität Pau und der Adour-Region haben sich Forschende dieser Fragestellung angenommen. Als Beispiel dienten Entenfedern, welche in der Bretagne in großen Mengen anfallen. Die Untersuchungen sind gleichermaßen auf alle Arten von Federn übertragbar. Zunächst stellte sich die Frage, welche Art von Klebstoff sich idealerweise und für welche Anwendung herstellen lassen würde. Die Entscheidung fiel auf ein wässriges System zum Kleben von Holz, da keine Lösemittel eingesetzt werden sollten und traditionelle Holzklebstoffe oft aus Proteinen bestehen.
Nachdem der Hydrolyseprozess optimiert wurde, konnte das Abbauprodukt des Keratins extrahiert, gereinigt und direkt zum Kleben von Holz verwendet werden. Hierzu wurden die Holzstücke nach dem Klebstoffauftrag verpresst, so wie man es von der Verwendung von Weißleim kennt. Bei der anschließenden mechanischen Prüfung der Klebverbindungen konnte eine überzeugende Klebkraft bestätigt werden. Weitere interessante Erkenntnis: Der federbasierte Klebstoff brennt ausgesprochen schlecht. Zukünftige Untersuchungen werden zeigen müssen, ob man diese Eigenschaft nutzen kann, um den Brandschutz von Holzprodukten zu verbessern.
Auch wenn bereits gute Klebergebnisse erzielt wurden, steht die Wissenschaft noch ganz am Anfang ihrer Forschung für federbasierte Holzleime. Es müssen nicht nur die Laborprozesse auf große Dimensionen skaliert, vielmehr muss auch die Wasserbeständigkeit der Klebverbindungen optimiert und die brandhemmende Wirkung eingehender untersucht werden. Für beide Aspekte gibt es bereits Konzepte, so dass federbasierte Holzleime in wenigen Jahren auf dem Markt verfügbar sein könnten – eine biobasierte und bioabbaubare Alternative zu synthetischen Holzleimen.
Quellen:
https://www.featherfolio.com/blog/five-million-tonnes-of-feathers-wasted-what-to-do
Nidal Del Valle Raydan, Katharina Richter, Bertrand Charrier, Andreas Hartwig, Eduardo Robles, Materials Today Sustainability 27 (2024) 100905, “Cold-set, crosslinker-free wood adhesives: A comparative study of ultrasound-extracted duck feather keratin and traditional food proteins”
DOWNLOADS:
Pressetext als PDF runterladen
Pressetext als DOC runterladen